„Angriffe auf NGOs sind Angriffe auf die Demokratie“
Stimmungsmache der FPÖ gegen NGOs. | Journalismus oder Aktivismus im nicht-kommerziellen Rundfunk?
Stimmungsmache der FPÖ gegen NGOs
Über 200 Seiten mit 2175 Fragen zu 725 Organisationen. Mit dieser umfassenden Anfrage an alle Ministerien wollte die FPÖ wissen wie viel Steuergeld der NGO-Sektor in Österreich erhält. Den Begriff NGO definiert sie darin durchaus breit: sie nennt kleine Vereine ebenso wie Forschungseinrichtungen, und sogar Organisationen, die keine öffentlichen Gelder erhalten sind in der Anfrage angeführt.
Die FPÖ stellt damit den gemeinnützigen Sektor unter Generalverdacht Steuergelder zu verschwenden. Diese pauschalen Attacken auf NGOs sind blanker Populismus, hieß es im Mediengespräch von Diskurs. Das Wissenschaftsnetz. „Rechtspopulistische Angriffe auf die Zivilgesellschaft sind Angriffe auf die Demokratie“, sagt Ruth Simsa, außerordentliche Professorin am Institut für Soziologie und empirische Sozialforschung an der Wirtschaftsuniversität Wien. Die FPÖ folge dabei einem Muster, das autoritäre oder rechtspopulistische Parteien weltweit anwenden, um die kritische Zivilgesellschaft einzuschränken. Das passiere oft als Prozess in kleinen Schritten: Rhetorik, Einschränkung der Partizipation, Finanzierung als Machtmittel und das Unterminieren von Grundrechten.
Laut Michael Meyer, Professor für Non-Profit Management an der WU Wien, habe die FPÖ historisch „ein gestörtes Verhältnis zu NPOs und NGOs.“ Das habe mit der ideologischen Verortung der meisten NPOs/NGOs zu tun: christlich-sozial, sozialdemokratisch, ökologisch-menschenrechtlich. Er spricht von „ziemlich besten Feinden“. NPOs und NGOs bezeichnet er als „hoch relevanter Sektor der Wirtschaft und Gesellschaft“. Zudem sind sie Sprachrohr von Menschen, die wenig repräsentiert sind, und sie vertreten grundlegende Werte bei Menschenrechten, im Klima- Umwelt oder Tierschutz. Eine Rolle, die unerlässlich für demokratische Systeme sei, sagen die Wissenschaftler:innen.
Journalismus oder Aktivismus?
Wo endet Journalismus und wo beginnt Aktivismus? Und wie hat Journalismus im nicht-kommerziellen Bereich eigentlich auszusehen?
Diesen und weiteren Fragen widmete sich am 30. Juni und am 1. Juli eine Zukunftswerkstatt vom Community Medien Institut COMMIT und dem Verband des Freien Rundfunks Österreich (VFRÖ). Inputs und Fachbeiträge aus der Wissenschaft und aus dem Medienbereich standen im Mittelpunkt.
Alexander Warzilek, Chef des österreichischen Presserats, spricht über den Presserat als eine Einrichtung für medienethische Selbstkontrolle. Dabei steht der Zuständigkeitsbereich des Presserats im Mittelpunkt. Durch wirtschaftliche, technologische und gesellschaftliche Veränderungen befinde sich der Journalismus im Wandel. Deshalb müsse der Aufgabenbereich des Presserats ausgeweitet werden, sodass Verstöße gegen ethische Grundsätze besser abgedeckt würden. Daher wurde auch über ein neues Grundverständnis von Journalismus gesprochen, welches die Einflussnahme auf die öffentliche Meinungsbildung in den Vordergrund stellt. Weitere Themen waren das raue Klima der österreichischen Medienlandschaft und rechtliche Maßnahmen zum Schutz von Qualitätsjournalismus.
Im Rahmen der Zukunftswerkstatt wurde auch über die Grenzen zwischen Journalismus und Aktivismus gesprochen. Petra Herczeg von der Universität Wien sieht im Journalismus eine geringere Einflussnahme auf die Meinungsbildung als im Aktivismus. Qualitativ hochwertiger Journalismus solle es Menschen ermöglichen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Im Fachbeitrag der Kommunikationswissenschaftlerin wurde auch Vielfalt als Qualitätsmerkmal im Journalismus thematisiert. Meinungsvielfalt sei ein grundlegendes Element journalistischer Berichterstattung, wobei es bei besonders heiß umstrittenen Themen wichtig sei, verschiedene Betrachtungsweisen korrekt zu gewichten. Auch mit der Diversität in Redaktionen müsse man sich laufend auseinandersetzen.
Oft wird ‚richtiger‘ Journalismus in Verbindung mit Idealen wie Objektivität, Neutralität und Unabhängigkeit gebracht. Der Politikwissenschaftler Andy Kaltenbrunner vom Medienhaus Wien aber sieht Begriffe wie Unabhängigkeit eher kritisch. Die Realität sei nicht so eindeutig. Ein hohes Maß an Objektivität, so Kaltenbrunner, könne auch einem Mangel an Empathie nahekommen. Außerdem bemängelt Kaltenbrunner die Überalterung im Journalismus sowie das begrenzte Angebot an Regionaljournalismus in Österreich.
Referent:innen:
Petra Herczeg (Universität Wien)
Andy Kaltenbrunner (Medienhaus Wien)
Helga Schwarzwald (VFRÖ)
Alexander Warzilek (Presserat)
Zuletzt geändert am 07.10.25, 14:32 Uhr
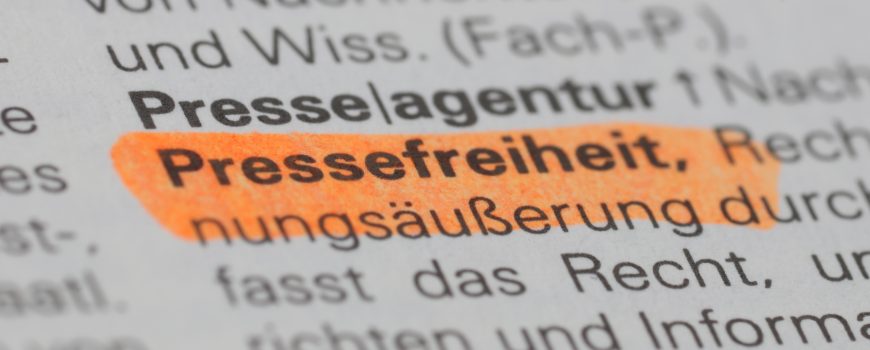
Kommentare werden von der Redaktion moderiert. Es kann daher etwas dauern, bis dein Kommentar hier erscheint. Wir behalten uns vor, diskriminierende oder diffamierende Kommentare, sowie solche, die straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, zu entfernen.